Projektpartner:innen Förderprogramm 2025
Im Oktober 2024 hat die Jury des Förderprogramms Digitalisierung Berlin ihre Empfehlung für neue Digitalisierungsprojekte zur Förderung an die Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt übergeben. Die Projekte wurden von Kultursenator Joe Chialo bestätigt. Insgesamt wurden 38 Anträge auf eine Projektförderung eingereicht.
Hier finden Sie Kurzinformationen zu den Inhalten der Digitalisierungsprojekte 2025 sowie die Namen der Ansprechpartner:innen in den Institutionen.
- Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv e. V.
- Brücke-Museum
- Freunde des Museums für Islamische Kunst im Pergamonmuseum e.V. (FMIK)
- Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA)
- Georg Kolbe Museum
- Käthe-Kollwitz-Museum Berlin
- Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin
- Stiftung Domäne Dahlem - Landgut und Museum
- Theater o.N.
Digitalisierung der grafischen Projektdokumentation der Berliner Gobelin-Manufaktur W. Ziesch & Co
 Ziel des Projekts ist die Digitalisierung von 700 Fotos und Abbildungen aus der grafischen Projektdokumentation der Berliner Gobelin-Manufaktur „W. Ziesch & Co“.
Ziel des Projekts ist die Digitalisierung von 700 Fotos und Abbildungen aus der grafischen Projektdokumentation der Berliner Gobelin-Manufaktur „W. Ziesch & Co“.
Die Nutzbarmachung des Bestandes soll Handwerkshistoriker:innen, Gobelinforscher:innen und anderen Wissenschaftler:innen sowie einer breiten Öffentlichkeit die Auseinandersetzung mit dem Kunsthandwerk ermöglichen.
Dazu ist eine Veröffentlichung in den Online-Portalen DDB, Europeana, Archivportal-D und findbuch.net vorgesehen.
Ansprechpartnerinnen Berlin-Brandenburgisches Wirtschaftsarchiv
- Waltraud Künstler
E-Mail: vorstand@bb-wa.de - Tania Estler-Ziegler
E-Mail: estler-ziegler@bb-wa.de
Gelebte Kunst – Brücke Kunsthandwerk und Skulpturen

Im Fokus des Projekts steht die vertiefte Beforschung des Kunsthandwerks, insbesondere in Bezug auf die verwendeten Techniken, die Nutzung der Objekte im Alltag, ihre Bezüge zu anderen Sammlungsstücken sowie das Mitwirken
weiterer Künstler:innen.
Die beeindruckende Vielfalt der Techniken und Gattungen der Brücke-Kunst, soll durch dieses Projekt stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Das Brücke-Museum plant im Rahmen seines Projekts die umfassende Digitalisierung von etwa 100 Objekten. Dazu zählen Skulpturen, Holzkästen, Rahmen, Schmuckstücke wie Ringe, Armbänder und Kettenanhänger sowie Schalen und andere Kunstwerke aus verschiedensten Materialien. Ziel ist es, rund 100 Datensätze grundlegend zu erschließen, inhaltlich zu überarbeiten und formal zu überarbeiten.
Ansprechpartner:innen Brücke-Museum
- Lisa Marei Schmidt
E-Mail: schmidt@bruecke-museum.de - Johannes Berger
E-Mail: berger@bruecke-museum.de
Website Brücke-Museum
Objekte online:
Schätze des Bildarchivs im Museum für Islamische Kunst – digitalisierte historische Fotos der Türkei
Freunde des Museums für Islamische Kunst im Pergamonmuseum e.V.
 Für diesen Antrag wurden drei wichtige Fotosammlungen (7.200 Fotos) des Museums für Islamische Kunst ausgewählt, deren Schwerpunkt auf der Türkeizwischen 1920 und 2000 liegt. Sie stammen von drei deutschen Fotografen: Wolfgang Zorer (1889-1940), Erhard Glitz (1904-1969) und Josef Härle (1937-2015). Viele der Dias von Erhard Glitz und Josef Härle entstanden in jener Zeit, als die meisten der damals „
Für diesen Antrag wurden drei wichtige Fotosammlungen (7.200 Fotos) des Museums für Islamische Kunst ausgewählt, deren Schwerpunkt auf der Türkeizwischen 1920 und 2000 liegt. Sie stammen von drei deutschen Fotografen: Wolfgang Zorer (1889-1940), Erhard Glitz (1904-1969) und Josef Härle (1937-2015). Viele der Dias von Erhard Glitz und Josef Härle entstanden in jener Zeit, als die meisten der damals „![]() Gastarbeiter“genannten Arbeitsmigrant:innen in die Bundesrepublik und nach Berlin kamen. Die digitalisierten Fotos bieten die Chance, sowohl Architektur als auch Alltagsgeschichte der Türkei im 20. Jahrhundert kennenzulernen. Für die große Community von Berliner:innen türkischer Herkunft finden sich vielleicht Anknüpfungspunkte an die eigene Familiengeschichte.
Gastarbeiter“genannten Arbeitsmigrant:innen in die Bundesrepublik und nach Berlin kamen. Die digitalisierten Fotos bieten die Chance, sowohl Architektur als auch Alltagsgeschichte der Türkei im 20. Jahrhundert kennenzulernen. Für die große Community von Berliner:innen türkischer Herkunft finden sich vielleicht Anknüpfungspunkte an die eigene Familiengeschichte.
Eine Teilauswahl der digitalisierten Fotos wird als Online-Ausstellung präsentiert. Zusätzlich ist eine Präsentation ausgewählter Werke geplant.
Ansprechpartner:innen Freunde des Museums Islamische Kunst
- Volkmar Wenzel
E-Mail: volkmar.wenzel@fmik.de - Anne Mollenhauer
E-Mail: anne.mollenhauer@syrian-heritage.org - Karin Pütt
E-Mail: karin.puett@syrian-heritage.org - Stefan Weber
E-Mail: s.weber@smb.spk-berlin.de - Tuyca Obruk Canpolat
E-Mail: tuyca.obruk@yee.org.tr - Samet Kapisiz
E-Mail: samet.kapisiz@yee.org.tr
Website Freunde Museums Islamische Kunst
Koloniale Verflechtungen an der Spree – Das Berliner Seminar für Orientalische Sprachen (1887-1942)
Geheimes Staatsarchiv in Kooperation mit der Staatsbibliothek zu Berlin und der Stiftung Stadtmuseum Berlin.
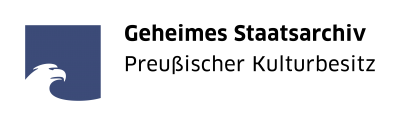 Mit diesem spartenübergreifenden Digitalisierungsvorhaben, das die Digitalisierung der Akten des Berliner Seminars für Orientalische Sprachen (SOS) am Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) zum Ziel hat, soll ein Beitrag zur Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit im Sinne des „Erinnerungskonzepts Kolonialismus für die Stadt Berlin“ geleistet werden.
Mit diesem spartenübergreifenden Digitalisierungsvorhaben, das die Digitalisierung der Akten des Berliner Seminars für Orientalische Sprachen (SOS) am Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) zum Ziel hat, soll ein Beitrag zur Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit im Sinne des „Erinnerungskonzepts Kolonialismus für die Stadt Berlin“ geleistet werden.
Die ausgewählten Akten spiegeln die Interessen deutscher Kolonial- und Handelspolitik wider, erlauben jedoch auch die Erforschung marginalisierter Stimmen von asiatischen und afrikanischen Akteur:innen in der Zeit Berlins als Kolonialmetropole. Um die Perspektive dieser bislang unterrepräsentierten Akteur:innen in der Vermittlung der Projektergebnisse zu stärken, kooperiert das GStA mit dem Stabi Lab der Staatsbibliothek zu Berlin (SBB). Nach Abschluss der Digitalisierung organisiert das GStA und die SBB in Zusammenarbeit mit der Kompetenzstelle DeKolonisierung im Berliner Stadtmuseum einen Editathon, um die bisherige Darstellung der Geschichte des Seminars in der Wikipedia, um eine diversitätsorientiere Perspektive zu erweitern.
Ansprechpartnerinnen Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
- Prof. Dr. Ulrike Höroldt
E-Mail: Ulrike.Hoeroldt@gsta.spk-berlin.de - Dr. Ramon Voges
E-Mail: Ramon.Voges@gsta.spk-berlin.de
Der schriftliche Nachlass Georg Kolbes – Neuentdeckungen aus dem Besitz der Enkelin Maria von Tiesenhausen mit Schwerpunkt auf die Jahre zwischen 1933 und 1945
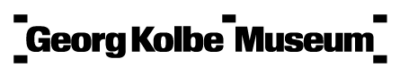 Das Georg Kolbe Museum ist seit seinem Bestehen nicht nur ein Ort, an dem Kunst gesammelt und ausgestellt wird, sondern auch ein Archiv. Den Grundstock dafür bildet der schriftliche Nachlass seines Namensgebers. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Korrespondenzen an und von Georg Kolbe. Besonders hervorzuheben sind zahlreiche Briefe von namhaften Künstlerkolleg:innen wie Ernst Barlach, Else Lasker-Schüler, Erich Heckel, Annette Kolb, Max Liebermann, Ludwig Mies van der Rohe und Karl Schmidt-Rottluff. Neben den persönlichen Briefwechseln umfasst der Nachlass auch eine umfangreiche Geschäftskorrespondenz mit bedeutenden Galerien, Museen, Kunstverlagen, Verbänden und Behörden.
Das Georg Kolbe Museum ist seit seinem Bestehen nicht nur ein Ort, an dem Kunst gesammelt und ausgestellt wird, sondern auch ein Archiv. Den Grundstock dafür bildet der schriftliche Nachlass seines Namensgebers. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Korrespondenzen an und von Georg Kolbe. Besonders hervorzuheben sind zahlreiche Briefe von namhaften Künstlerkolleg:innen wie Ernst Barlach, Else Lasker-Schüler, Erich Heckel, Annette Kolb, Max Liebermann, Ludwig Mies van der Rohe und Karl Schmidt-Rottluff. Neben den persönlichen Briefwechseln umfasst der Nachlass auch eine umfangreiche Geschäftskorrespondenz mit bedeutenden Galerien, Museen, Kunstverlagen, Verbänden und Behörden.
Im Laufe der 1970er Jahre wurde jedoch ein zentraler Teil der Dokumente von Kolbes Enkelin Maria von Tiesenhausen (1929–2019) von Berlin nach Vancouver verbracht, wo die damalige Leiterin des Georg Kolbe Museums ihren eigentlichen Lebensmittelpunkt hatte. Da im Museum kein vollständiges Inventar des Schriftguts existierte, blieben Umfang und Inhalt der von ihr entnommenen Archivalien lange Zeit unbekannt. Erst nach ihrem Tod konnte der Nachlass in Kanada gesichtet werden. Mit der Rückführung nach Berlin 2020 ist der Künstlernachlass nach über 50 Jahren wiedervereint.
Im Fokus des beantragten Projekts steht der wiederentdeckte schriftliche Nachlassteil aus Kanada. Neben den ca. 2.300 Einzelbriefen an und von Georg Kolbe umfasst die Korrespondenz weitere 50 Briefwechsel und acht Briefkonvolute. Ferner handelt es sich um bisher unbekannte Lebensdokumente, wie 28 Taschenkalender, Besuchs- und Telefonkalender sowie persönliche Adressbücher, die zukünftig nicht mehr nur der Forschung im Haus vorbehalten sein sollen, sondern vor allem der interessierten Öffentlichkeit und der internationalen Forschung zur Verfügung gestellt werden sollen.
Ansprechpartnerinnen Georg Kolbe Museum
- Carolin Jahn
E-Mail: jahn@georg-kolbe-museum.de - Kathleen Reinhardt
E-Mail: reinhardt@georg-kolbe-museum.de
Website Georg Kolbe Museum
KOLLWITZ DIGITAL – Digitale Zusammenführung grafischer Arbeiten von Käthe Kollwitz aus den vier wichtigsten Berliner Sammlungen
In Kooperation mit der Akademie der Künste Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin und der Stiftung Stadtmuseum Berlin.
Im Berlin um die Jahrhundertwende begann die junge Künstlerin Käthe Kollwitz (1867-1945) ihren Aufstieg zu einer der wohl bedeutendsten Künstlerinnen Deutschlands.Über 50 Jahre lang lebte und arbeitete die gebürtige Königsbergerin in der schnell wachsenden Metropole und wurde Zeugin der sich verstärkenden sozialen Missstände und Probleme innerhalb der Stadt.
In Berlin sind Zeichnungen und Druckgrafiken von Käthe Kollwitz![]() in einigen großen musealen Sammlungen vertreten, neben dem Käthe-Kollwitz-Museum im Stadtmuseum Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museum sowie in der Kunstsammlung der Akademie der Künste. Die Sammlung des
in einigen großen musealen Sammlungen vertreten, neben dem Käthe-Kollwitz-Museum im Stadtmuseum Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museum sowie in der Kunstsammlung der Akademie der Künste. Die Sammlung des 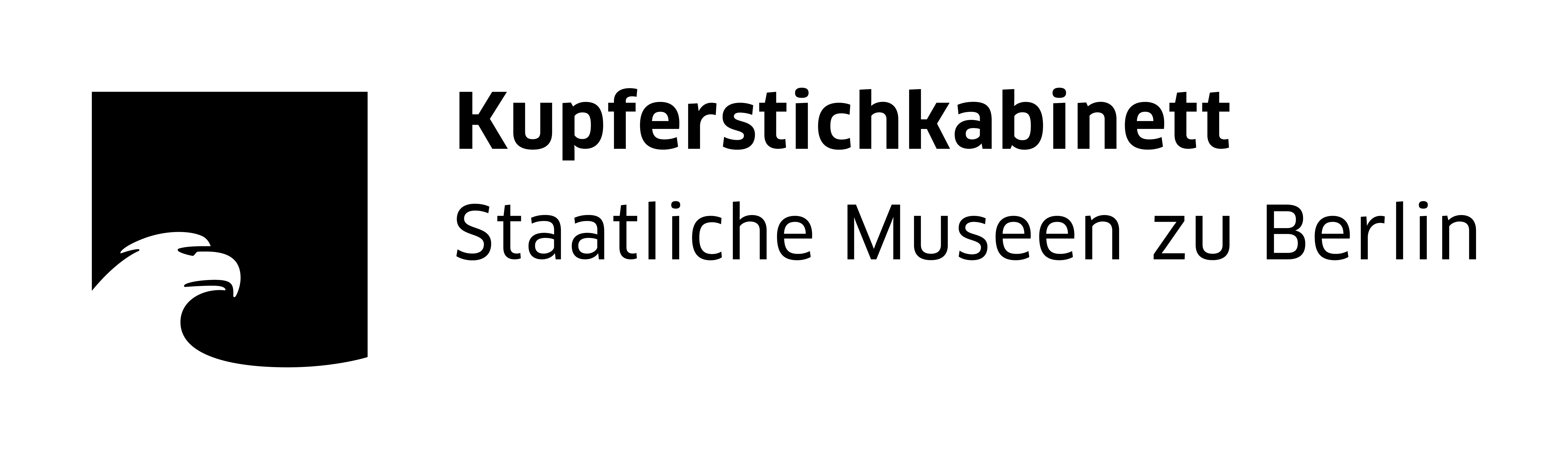 Käthe-Kollwitz-Museums Berlin geht auf die Kollektion eines privaten Kunstkenners in West-Berlin zurück, des ehemaligen Kunsthändlers Hans Pels-Leusden (1908–1993). Diese Sammlung ist daher weniger auf Vollständigkeit angelegt. Stattdessen spiegelt sie
Käthe-Kollwitz-Museums Berlin geht auf die Kollektion eines privaten Kunstkenners in West-Berlin zurück, des ehemaligen Kunsthändlers Hans Pels-Leusden (1908–1993). Diese Sammlung ist daher weniger auf Vollständigkeit angelegt. Stattdessen spiegelt sie
Das Kooperationsprojekt „Digitale Zusammenführung grafischer Arbeiten von Käthe Kollwitz aus den vier wichtigsten Berliner Sammlungen der vier Berliner Häuser“ möchte den Kollwitz-Bestand der musealen Sammlungen digitalisieren und in einer gemeinsamen dauerhaften Online-Präsentation für eine breite Öffentlichkeit zugänglich machen.
Ansprechpartner:innen Käthe Kollwitz Museum
- Josephine Gabler
E-Mail: j.gabler@kaethe-kollwitz.de - Astrid Böttcher
E-Mail:museum@kaethe-kollwitz.de - Andreas Schalhorn
E-Mail: a.schalhorn@smb.spk-berlin.de - Anna Schultz
E-Mail: schultz@adk.de - Michael Bischoff
E-Mail: michael.bischoff@stadtmuseum.de
Website Käthe-Kollwitz-Museum
Ausbildung, Fabrik, Produkt – AEG-Fotoalben der Werkschule in Berlin-Reinickendorf und der Maschinenfabrik Brunnenstraße in Berlin Wedding

Gegenstand dieses Projekts sind zwei zwei Konvolute von AEG-Fotoalben der Werkschule in Berlin-Reinickendorf und der Maschinenfabrik Brunnenstraße in Berlin Wedding. Diese bieten einen wertvollen Einblick in das soziale Leben der Auszubildenden, die später als Dreher, Feinmechaniker, Maschinenschlosser, Modelltischler und Former in der Produktion tätig wurden. Hinzu kommen Fotos der Produktionsstätte, ihrer Ausstattung und Ausgestaltung. Die meisten Alben enthalten Fotos der Produkte, von kleinen Messgeräten bis zu großen Maschinen. Zusammen sind diese Bildquellen eine Dokumentation der Arbeitswelt und Arbeitswirklichkeit in Zeiten des Umbruchs und Wandels. Die Ergebnisse des Projekts sollen durch verschiedene digitale Vermittlungsformate zugänglich gemacht werden.
Ansprechpartner Deutsches Technikmuseum
- Gerhard Rammer
E-Mail: rammer@technikmuseum.berlin - Joachim Breuninger
E-Mail: breuninger@technikmuseum.berlin
Website Deutsches Technikmuseum
Agrargeschichte digital – Fotos des Berliner Agrarjournalisten Hans Haase
Das beantragte 
Hans Haase (1902-1994) war Dozent an der landwirtschaftlichen Peter Lenné-Schule in Berlin und veröffentlichte den „Ratgeber für den praktischen Landwirt“. Er dokumentierte als Fotograf die landwirtschaftliche Produktion und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, vorwiegend in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern.
Seine Fotografien zeigen auf eindrucksvolle Weise den Wandel von traditionellen Wirtschaftsweisen hin zur Technologisierung und Produktionsoptimierung in der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert.
Ein übergeordnetes Anliegen des Projektes ist es, die Geschichte der Landwirtschaft und der damit verbundenen sozialen und ökologischen Transformationen unter den aktuellen Perspektiven von ökologischer Landwirtschaft als ressourcensparende Alternative gegen den Klimawandel und Rohstoffknappheit zu vermitteln.
Zu diesem Zweck sind drei Vermittlungsangebote vorgesehen: eine digitale Ausstellung auf der DDB oder museum-digital, eine Podiumsdiskussion mit Expert:innen über landwirtschaftliche Fotografie (im Format „Hofgespräch“) sowie ein Workshop für Schüler:innen vor Ort.
Ansprechpartnerin Stiftung Domäne Dahlem
- Dennis Novak
E-Mail: novak@domaene-dahlem.de
Website Stiftung Domäne Dahlem
Objekte online:
„Die Bremer Stadtmusikanten“ von Zinnober/Theater o.N. – Archivalien aus drei Jahrzehnten Freier Theaterszene in Berlin (1986-2019)

Die Geschichte des Theaters wird digital anhand des Bühnenstücks der „Bremer Stadtmusikanten“ erzählt – ein Schattenspiel nach dem Märchen der Brüder Grimm, „erzählt mit Figuren, eigenen Händen, Licht und Schatten, Live-Musik und Geräuschen…“. Das Stück befand sich mit Originalbesetzung und -bühnenbild ab 1986 über 30 Jahre auf dem Spielplan des Theaters. Die Puppenfiguren wurden nie erneuert, sie sammelten über die Jahre mit mehr als 1000 Vorstellungen unzählige Spuren auf, die sie selbst zu lebendigen Zeitzeugen werden lassen. Zwei der damaligen Spieler:innen geben in Form von Zeitzeug:inneninterviews vertiefte Einblicke in die damalige Theatergeschichte. Die Projektergebnisse werden zum Abschluss in einem Kulturellen Salon am Theater o.N. vorgestellt.
Ansprechpartnerin Theater o.N.
- Doreen Markert
E-Mail: markert@theater-on.de
Website Theater o.N.
