Workshops und Vorträge
Am 11. Juli beteiligte sich Alexander Winkler mit einem Impulsvortrag am 23. KOBV-Forum und betrachtete darin Bibliotheken als ‚Datenzentren‘ (Slides unter https://doi.org/10.5281/zenodo.15832319), d.h. als Institutionen, die neben klassischen Medien zunehmend auch Daten aggregieren, generieren und bereitstellen. Anhand von konkreten Beispielen wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Bibliotheken dieses datenfokussierte Rolle ausfüllen können.
In diesem Quartal fanden wie auch 2024 zwei Einführungsworkshops zum Thema KI/ML statt: Am 14. Juli brachten Marco Klindt und Xenia Kitaeva mit dem Online-Workshop „Deus ex machina? Eine Einführung in die Grundlagen des maschinellen Lernens für Kulturerbeinstitutionen“ über 50 Teilnehmenden aus dem Kulturbereich die Grundlagen aktueller Machine-Learning-Technologien näher. Die Slides von Xenia Kitaeva sind unter https://doi.org/10.5281/zenodo.15913647 zu finden.
Am Nachmittag des 14. Juli folgte der Workshop „KI und (Urheber-)Recht für Kulturerbe-Institutionen” mit Prof. Dr. Paul Klimpel (iRights Law). Die über 70 Teilnehmenden auf Zoom diskutierten rege zu seinen Einschätzungen der rechtlichen Rahmenbedingungen beim Einsatz KI-basierter Verfahren in Kultureinrichtungen und bei der Bereitstellung von Daten für KI-Anwendungen.
Der August war bei digiS gewohnt etwas ruhiger und gefüllt mit Tätigkeiten hinter den Kulissen.
Vom 24. bis 26. September fand an der Universität Rostock die FORGE 2025 statt, eine Fachtagung zum Thema „Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften“. Unter aktiver Mitarbeit von digiS hat die Arbeitsgruppe ‚Digitales Museum‘ des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum e.V. (DHd) einen Workshop mit dem Titel „Sammlungen als Forschungsdaten. Datennutzung als Gemeinschaftsaufgabe“ abgehalten. Die Slides zum Workshop sind unter https://doi.org/10.5281/zenodo.17209352 zu finden, das Workshopabstract unter https://doi.org/10.5281/zenodo.17178222.
Am 25. September hielt Xenia Kitaeva den Vortrag „Einführung in Machine Learning für Kultuerbeinstitutionen“ für Mitarbeitende der Friedenstein Stiftung Gotha (in Gotha). Die Einführung führte zu einer interessierten Diskussion über allgemeine Fragen zum Thema, aber auch zu ethischen Aspekten der KI-Nutzung im eigenen Haus.
digiS Stammtisch
Am 24. September trafen wir uns mit einigen unserer Projektpartner:innen zum Stammtisch der Projekte 2025. Die Kolleg:innen des Archivs der Akademie der Künste (Kooperationspartner im 2025er-digiS-Projekt „Kollwitz digital“) teilten in informeller Runde ihre Methoden und Erfahrungen bei der Digitalisierung ihrer Objekte.
Langzeitarchivierung (LZA)
Im Juli stand fand die öffentliche Ergebnispräsentation unserer LZA-Bedarfsumfrage statt. Am 17. Juli luden wir zusammen mit Prof. Dr. Martin Zierold dazu ein, mit uns die Ergebnisse unserer vorherigen Umfrage bei den digiS- und KOBV-Partner:innen zu ihren Bedarfen im Bereich Langzeitarchivierung/Langzeitverfügbarkeit zu besprechen. Im September fanden zusätzlich vertiefte Fokusgruppengespräche statt. Eine weitere Neuerung in unserem Service zur Langzeitarchivierung ist die Veröffentlichung unseres neuen digitalen Tools „Best Match”. Mit der Webanwendung Best Match können ab jetzt Datenlieferungen für das von digiS und dem KOBV betriebene Langzeitarchiv EWIG vor der Übergabe von den datengebenden Institutionen selbstständig auf Vollständigkeit überprüft werden.
Vorbereitungen für die digiS Jahreskonferenz 2025
Die Vorbereitungen für die digiS-Jahreskonferenz „Datenkultur(en): Kooperation macht den Unterschied“ sind in den letzten Monaten vorangeschritten. Mittlerweile ist die Anmeldung geöffnet, das Programm steht und die Einladung wurde versendet. Wir freuen uns sehr auf die Präsentation der Ergebnisse unserer diesjährigen Projektpartner:innen, auf die Vorträge, auf die Panelist:innen und Moderator:innen! Denn unser Konferenzthema „Kooperation“ beschäftigt uns nicht nur im Zusammenhang mit unseren Projekten, sondern auch im Bereich von Infrastrukturen, Daten und der teaminternen Zusammenarbeit:
Kooperationsprojekte bringen nicht nur Potenziale, sondern auch Herausforderungen mit sich – etwa in der Kommunikation, Koordination und im Umgang mit Ressourcen, Daten und Wissen. Sie fordern uns heraus, unsere eigenen Perspektiven, Routinen und Haltungen kontinuierlich zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Mit unseren Gäst:innen aus Kulturerbeeinrichtungen, besprechen wir wie Digitalisierung und KI unsere Zusammenarbeit verändert. Virtuelle Teams, vernetzte Daten und neue Mensch-Maschine-Interaktionen prägen unseren Arbeitsalltag zunehmend. Welche Bedingungen braucht es also heute, damit diese neuen Formen der Kooperation gelingen?
MitdiskutierenFörderprogramm
Am 25. Juli endete die Ausschreibung zum „Förderprogramm Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes des Landes Berlin“ für die Laufzeit 2026. Im Sommer haben wir also fleißig Anträge gesichtet und legten diese im Oktober der digiS-Jury vor.
Erste Ergebnisse des 2025er Digitalisierungsprojektes der Stiftung Domäne Dahlem (Agrargeschichte digital – Fotos des Berliner Agrarjournalisten Hans Haase) sind bereits in museum-digital abrufbar: https://berlin.museum-digital.de/collection/1272.
digiS macht und tut
Wir basteln weiterhin zusammen mit museum-digital fleißig am LLM-gestützten Objektbeschreibungstool in musdb und freuen uns über rege Nutzung durch musdb-Nutzende! Weitere und weiterführende Informationen gibt es hier: md x digiS = KI & Objektbeschreibungen
Podcast veröffentlicht
Im September ist eine neue Folge des digiS-Podcasts erschienen. Im Gespräch mit Esra Paul Afken (Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft) und Lorraine Bluche (Stiftung Stadtmuseum Berlin) spricht unsere Kollegin Xenia Kitaeva über den Umgang mit Digitalisaten „komplexer” und problematischer Objekte. Konkret geht es um die Komplexität zweier digiS-Projekte aus der Laufzeit 2024: Einerseits betrifft dies die Sammlung des ehemaligen Instituts für Sexualwissenschaft, bei der die angemessene Veröffentlichung fotografischer Inszenierungen von als „anders“ markierten, oft nackten Körpern eine Herausforderung darstellte. Zum anderen geht es um eine Sammlung von Bilderbögen im Stadmuseum. Der Bilderbogen war im 19. Jahrhundert einerseits ein beliebtes Informations- und Unterhaltungsmedium, andererseits repräsentierte dieses Medium kolonialrassistische Darstellungen und ist damit auch heute noch alles andere als harmlos. Die öffentliche Zugänglichmachung solchen Materials ist hochkomplex, lädt dazu ein, die eigene institutionelle Praxis zu hinterfragen und auf nach wie vor vorhandene koloniale Strukturen zu untersuchen.


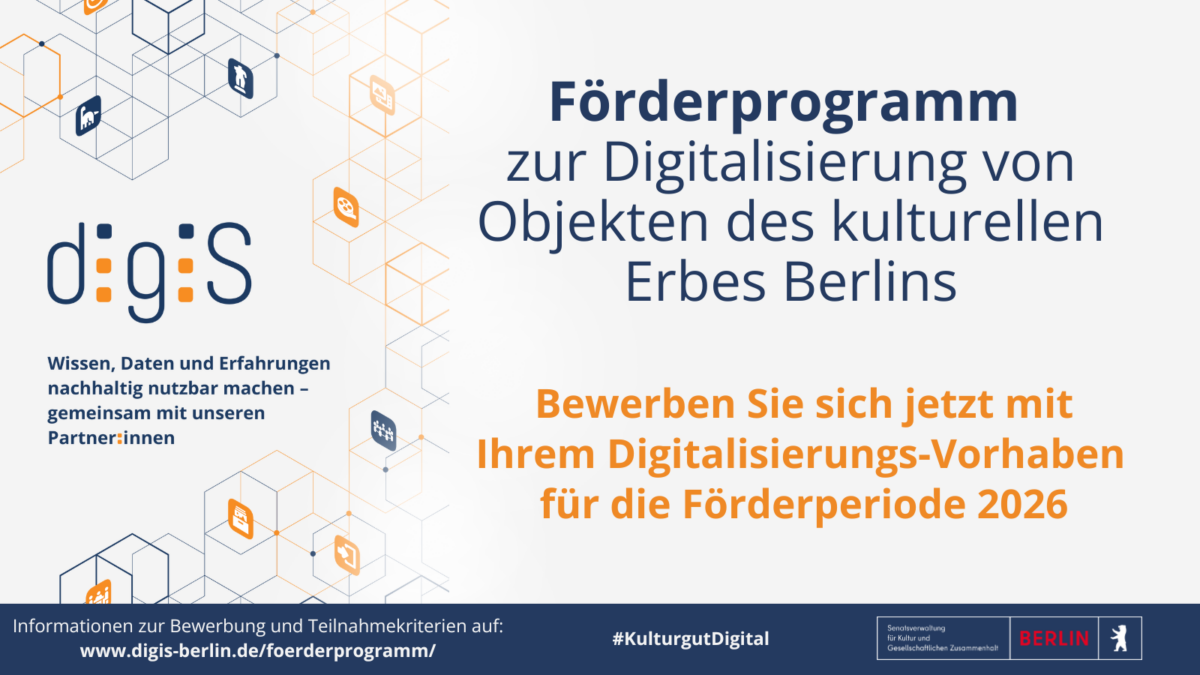
 Wir laden ein zum Workshop „Einsatz und Anwendung kontrollierter Vokabulare und Normdaten„!
Wir laden ein zum Workshop „Einsatz und Anwendung kontrollierter Vokabulare und Normdaten„!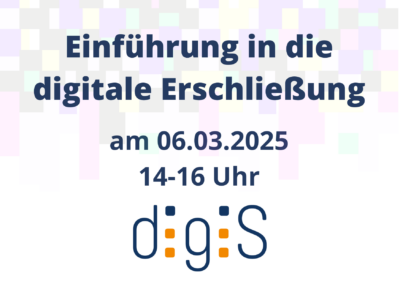 Am 06. März laden wir wieder ein zu einer Einführung ins digitale Erschließen.
Am 06. März laden wir wieder ein zu einer Einführung ins digitale Erschließen.


